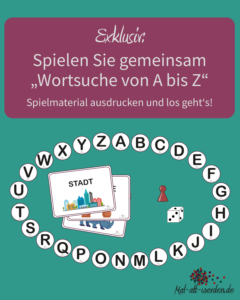Gemeinschaft und Schweigen im Pflegeheim – Das Interview

Im Gespräch mit Viktoria Christov
Gestern haben wir das Buch “Gemeinschaft und Schweigen im Pflegeheim” vorgestellt. Lesen Sie heute das wirklich interessante und anregende Interview mit der Autorin.
Hallo Frau Christov, stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
Hallo, ja sehr gern. Mein Name ist Viktoria Christov und ich bin 29 Jahre alt. Geboren in Berlin, wuchs ich später im grünen Hohenlohe auf. Die mir bis dahin logisch aufgebaute Welt stand das erste Mal mit sechzehn Jahren langfristig Kopf, als ich ein Austauschjahr in Guatemala verbrachte. Das Interesse an diesen kulturellen und zwangsläufig kognitiven Turbulenzen war dann nach dem Abitur ein ausschlaggebender Grund dafür, das Studienfach Ethnologie näher zu beäugen (auch als Kultur- und Sozialanthropologie bekannt). Das tat ich dann an der Uni Heidelberg und der Uni Freiburg. Parallel dazu begann ich ein Ehrenamt im Besuchsdienst von Pflegeheimen und die Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin. Dabei war ich zu jenem Zeitpunkt die mit Abstand Jüngste in den Begleitergruppen, wurde mit Verwunderung, aber auch Herzlichkeit aufgenommen. Heute gehören Ethnologie und Altenarbeit fest zu meinem Sein, das ich aktuell in Heidelberg angesiedelt habe.
Sie haben kürzlich Ihr Buch „Gemeinschaft und Schweigen im Pflegeheim“ veröffentlicht. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
Das Brennen für dieses Thema begann bereits zur Mitte meines Studiums. Dabei zog ich vom Königstuhl in den Schwarzwald und lernte so ein neues Pflegeheim kennen. Auch dort empfand ich die Besuchsstunden im Wohnbereich immer als sehr besonders und irgendwie außeralltäglich, wofür ich aber jedes Mal eine neue, sehr subjektive Erklärung fand. Erst als ich nach vielen Uni-Seminaren zu Mikronesien, Indien und Indonesien die Entscheidung traf, mich als Ethnologin weniger mit der Erforschung des „Fremden in der geographischen Ferne“ sondern umgekehrt, mit der „Entfremdung und Erforschung des angeblich Bekannten in meiner näheren Umgebung“ zu beschäftigen, loderte das Feuer richtig auf. So landete die besondere Atmosphäre im Pflegeheim dann auch auf meinem Schreibtisch und dem Wochenprogramm meiner ProfessorInnen. Die wissenschaftliche Frage lautete dann bald: Warum wird unter den SeniorInnen im Pflegeheim eigentlich so viel geschwiegen? Das wurde dann auch zur Leitfrage für meine Masterforschung.
Für Ihre Arbeit sind Sie für drei Wochen selbst in ein Pflegeheim eingezogen. Was hat Sie zu diesem Schritt bewegt?
In dem Bestreben, ein „waschechter“ Ethnologe zu sein, kommt man um diesen klassischen Schritt eigentlich fast nicht herum. Dabei dauern ebenjene „Teilnehmenden Beobachtungen“ im Rahmen der „Feldforschung“ schon mal ein ganzes Jahr oder sogar länger. Ziel ist es, die Perspektive von Menschen verstehen zu lernen, indem man an deren Alltagsgeschehen teilnimmt und langfristig Nähe aufbaut. Gleichzeitig gilt es aber auch als ForscherIn, Distanz und Reflexion zu wahren, um eine wissenschaftliche Erkenntnis zu ermöglichen – ein ziemlich individueller Balance-Akt also!
Während der Planung meiner eigenen Forschung – für die ich lediglich drei Monate Zeit hatte – schoss mir der Gedanke, einfach direkt in ein Heim einzuziehen natürlich einige Male durch den Kopf. Nicht nur, weil ich die Vorstellung unglaublich spannend fand, sondern auch, da mir keine andere Methode bekannt war, mit der ich mein besonderes Vorhaben hätte umsetzen können. Zum Ziel hatte ich mir nämlich nicht nur die Beantwortung meiner Fragestellung gemacht, sondern auch, mich der Perspektive der SeniorInnen dabei methodisch so gut es geht anzunähern. Der einfachste Weg war natürlich, die SeniorInnen einfach direkt zu befragen. Das tat ich auch – wenngleich erst am Ende der Forschung. Wichtig war mir dabei, InterviewpartnerInnen nicht anhand ihrer kognitiven Voraussetzungen für eine Teilnahme zu begünstigen oder auszuschließen – jede individuelle Wahrnehmung erhält in der Arbeit so ihre 100% an Aussagekraft und Relevanz.
Trotzdem konnten Interviews ja nur einen Teil der Erkenntnis bringen. Denn was der Mensch sagt, das er denkt und tut, ist nicht immer das, was seinem tatsächlichen Denken und Verhalten entspricht. Folglich war es zentral, das Miteinander der BewohnerInnen zu „erleben“, und das möglichst auf gemeinsamer Augenhöhe. Das wiederum, funktionierte weder über ein Pflegepraktikum (mit unterschiedlich verteilter Freiheit und Verantwortung) noch über zeitlich begrenzte Besuche während des Tages (ohne die reichhaltige Wahrnehmung während der Nächte). Es war also ein hinreißender Gedanke, eine räumliche und zeitliche Kontinuität durch einen Einzug herstellen zu können. Glücklicherweise war ich dem Pflegeheim meiner Wahl bereits durch ein Ehrenamt bekannt, was ein erstes Vertrauen schuf. Darüber hinaus zeigte dann aber auch der Heimleiter für mein Vorhaben und meine Überlegungen größtes Verständnis und bot mir so direkt am ersten Tag meiner Forschung ein Bett in einem Doppelzimmer an.
Was haben Sie persönlich, neben Ihrer Arbeit, aus der Zeit dort mitnehmen können?
Oh je, da gibt es unsagbar viel. Vor allem eine große Dankbarkeit für die Geduld, den Charme und die Ehrlichkeit der SeniorInnen. Im Alltag selbst bemerke ich aber auch immer wieder eine verstärkte Analyselust, was menschliche Wahrnehmung und Ausdrucksform anbelangt, was auf die Dauer ganz schön erschöpfend sein kann. Und dann natürlich auch die Erkenntnis, dass ich sehr undiszipliniert in der Bearbeitung von Rätselheften bin.
Das Thema „Schweigen im Pflegeheim“ umfasst ein ganzes Buch, wenn nicht noch mehr ;-)…Sie haben dort einige unterschiedliche Gründe aufgezeigt, warum die Bewohner „schweigen“. Können Sie unseren Lesern diese verschiedenen Mechanismen hier im Interview einmal ‚kurz‘ erklären?
Die Mechanismen sind tatsächlich komplex, aber gut nachvollziehbar. Mir als Forscherin offenbarten sich zunächst viele Ursachen für ein Schweigen in der Gruppe, die für den Leser nicht verwunderlich sein mögen. Also zum Beispiel unpassende Stimmungslagen mit schweren Gefühlen und Gedanken, eine introvertierte Wesensart, gewisse Erkrankungen, die die Kognition maßgeblich beeinflussen oder das Fehlen geeigneter GesprächspartnerInnen oder Gesprächsatmosphären. Die Bandbreite der Gründe ist sehr vielfältig.
Durch die intensive Teilnehmende Beobachtung und die Interviews taten sich aber zwei zentrale Empfindungen auf, die vieles erklären, nämlich (kommunikative) Enttäuschung und (relative) Ungleichheit. Die Enttäuschungen entstehen bei vielen SeniorInnen auf der Grundlage dessen, dass sich die Kommunikation im Pflegeheim (durch die Vielfalt der oben genannten Faktoren) als außergewöhnlich komplex und riskant erweist (Auf was lasse ich mich in einem Gespräch ein? Wie reagiert der andere auf mich? Kann ich selbst adäquat reagieren?). Die erlebten Enttäuschungen (wie Beleidigung, Missverständnis oder das eigene Unvermögen) münden dabei bei vielen BewohnerInnen in einer Resignation („Dann sag ich jetzt eben gar nichts mehr.“) oder einem situativem Selbstschutz („Dann geh/schweig ich eben.“). Nur sehr wenige investieren trotz alledem noch Motivation und Ressourcen in Gespräche.
Während der Interviews ließen wiederum viele BewohnerInnen die oben genannte Ungleichheit erkennen. Dabei fühlten sie sich ihren MitbewohnerInnen gegenüber offensichtlich entweder überlegen, unterlegen oder aber schlichtweg anders (wobei Altenheimklischees und Selbstfokus (z.B. durch Schmerzen) eine besondere Rolle spielen). Einige SeniorInnen berichteten von einer starken Unsicherheit gegenüber den anderen, weil z.B. die Kenntnis von Namen fehle oder man sich persönlich nicht auf dem Laufenden über Todesfälle und Neueinzüge gehalten fühle. Letztlich äußerte sich nur eine Minderheit dahingehend, trotz aller Differenzen, eine gewisse Gleichheit zwischen sich und den MitbewohnerInnen zu empfinden.
´Kurz´ und gut: um alledem im Rahmen des Lebens im Pflegeheim zu begegnen, reagiert die Mehrheit der BewohnerInnen (mich zeitweise eingeschlossen) mit einem unverfänglichen Schweigen. Das Schweigen löst also offenbar die Komplexität im Miteinander einer vielfältigen Bewohnerschaft und ermöglicht so eine provisorische Harmonie und Sicherheit. Provisorisch deshalb, da die genannten Unsicherheiten und Differenzen unter den BewohnerInnen nur selten verbal geklärt werden. Man kann also sagen, dass das Schweigen zu einer Art Bewältigungsstrategie und Kompetenz wird.
Gibt es, Ihrer Erfahrung nach, Möglichkeiten, diese Verhaltensmuster zukünftig zu durchbrechen bzw. Räume zu schaffen in denen sie nicht „nötig“ sind?
Ich denke, dass es zu Beginn solcher Überlegungen wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass Gespräche nicht das strikte Ziel sein dürfen. Gespräche (aller Art) unter den BewohnerInnen können zwar ein Zeichen dafür sein, dass Stimmung, Atmosphäre und Gegebenheiten gut oder im Werden sind. Trotzdem bestehen die Wohngruppen aus Individuen, die auch ihre legitimen Gründe für eine kurz- oder langfristige verbale Enthaltung haben dürfen. Auch hier gilt es also wieder geduldig und aufmerksam auszuloten, ob eine Animation oder Leitung von außen (z.B. zur Eingewöhnung eines neuen Bewohners) sinnvoll ist.
Lohnenswert ist meiner Meinung nach insbesondere die Förderung von Selbstständigkeit und sozialer Dynamik. Nur so erhält eine “gefühlte”, also tatsächliche Gemeinschaft nämlich überhaupt erst die Chance, sich zu entwickeln. Man könnte sich also im interdisziplinären Team (und ggf. auch mit BewohnerInnen) zusammensetzen und beraten, inwiefern die Struktur und das Wochenprogramm verändert werden können, auf dass Pflegealltag und Leben nicht nur in Sicherheit und Orientierung, sondern auch Selbstständigkeit und sozialer Dynamik möglich werden. Darüber hinaus sind natürlich auch leicht zugängliche Räumlichkeiten und Bereiche vielversprechend, die zu einem (ungestörten) Verweilen einladen. Auch von einer ausführlichen Vorstellungsrunde neuer BewohnerInnen auf dem Wohnbereich könnte ich mir eine größere Sicherheit im gegenseitigen Umgang der SeniorInnen versprechen. Letztlich kennt aber jedes Heim seine BewohnerInnen und Möglichkeiten am besten und muss herausfinden, welche Initiativen wirklich durchführbar sind. An bereits etablierten, sinnvollen Ideen und Erfahrungen bin ich sehr interessiert und freue mich über Anregungen!
Können Sie uns vielleicht eine kleine Anekdote oder Geschichte erzählen, an die Sie sich aus Ihrer Zeit im Pflegeheim gerne zurück erinnern?
Sehr gern erinnere ich mich an ein Gespräch zwischen zwei Bewohnerinnen und mir am Kaffeetisch (Namen anonymisiert):
Frau Waldmann: „Was machen Sie in Freiburg?“
Ich: „Meinen Abschluss in Ethnologie!“
Frau Waldmann: (–)?
Frau Peters: (–)?
Ich: „Ethnologie!“
Frau Peters: „Ah! Vögel!“
Ich: „Nee. So wie Kulturwissenschaften.“
Frau Peters: „Ah (–) da muss man das Innere der anderen nach
außen kehren.“
Ich: „Genau!“
Frau Peters: „Das ist (–) (zu Frau Waldmann) so, wie wenn ich dir
die Haut abziehe.“
Frau Waldmann: „Das schaffst du nicht!“
Frau Peters: „Ich ziehe dir die Haut ab und schaue, ob du drunter
bist wie draußen!“
Frau Waldmann: „Haha, das schaffst du nicht.“
Frau Peters: „Also ich bin ja innen viel schöner als außen!“
Frau Waldmann: „Ja?“
Was wünschen Sie sich von der Zukunft?
Dass sich Ideale und Kreativität bei der Pflege von Menschen wieder lohnen. Und das nicht nur in den Köpfen von GesetzgeberInnen, WissenschaftlerInnen und AusbilderInnen, sondern auch im täglichen Wirken aller Parteien, die an praktischer Pflege beteiligt sind. Denn was bringt mir eine vielversprechende Erkenntnis in einem Dokument, wenn sie für die Pflegekraft utopisch in ihrer Durchführung bleibt? Nur wenn Pflege- und Betreuungskräfte (auch ihre eigenen) Ideale tatsächlich in den Pflegealltag einbringen können, halten sich meines Erachtens auch die Selbstwirksamkeit, das Teamwork und die Pflege der Gepflegten auf einem bestärkenden und lebenswerten Level.
Zudem wünsche ich mir, dass ForscherInnen zukünftig mehr Ressourcen – insbesondere Zeit – aufbringen können, um in ihrer Datensammlung auch die Unwägbarkeiten und Überraschungen des sozialen Forschungsfeldes zu berücksichtigen und ihre Analyse – für das Feld, den Leser und sich selbst – moralisch und transparent zu hinterfragen.
Herzlichen Dank, Frau Christov!!!
Danke an Sie.
Zur Internetseite: Mabuse-Verlag
Lesen Sie unsere Buchvorstellung zu “Gemeinschaft und Schweigen im Pflegeheim”